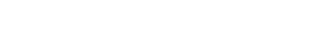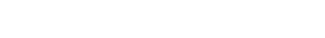Kochen heißt sich etwas Gutes tun

Carl-Josef Kutzbach
Dienstag, 1. Oktober 2019
Weil viele so gehetzt sind, wollen sie sich dafür am Feierabend verwöhnen lassen, gehen Essen, oder bestellen Essen ins Haus, das sie höchstens noch in der Mikrowelle warm machen und mampfen das dann - oft ganz alleine - neben dem Fernsehprogramm. Esskultur? Fehlanzeige. Essen wird wie das befüllen des Treibstofftanks bei einer Maschine als notwendige Verrichtung angesehen, die unnötig viel Zeit kostet, also isst man häufig unterwegs im Gehen.
Was ist da passiert?
Frühstück, Vesper, Mittagessen, Kaffeetrinken und Abendbrot, waren früher die selbstverständlichen Mahlzeiten, bei denen sich die Familie traf. Ja den Bauern wurde das Vesper oder auch das Mittagsmahl in Erntezeiten auch mal auf‘s Feld gebracht. Aber erst mit der Trennung von Arbeit und Wohnen, fehlten einzelne, meist zunächst die Männer, später auch die Frauen beim gemeinsamen Essen und heute wird in manchen Familien nur noch einmal in der Woche gekocht, wenn überhaupt.
Statt der Familie mit samt den Mägden, Knechten und Dienstboten, sowie den Handwerkern, die manchmal für eine gewisse Zeit im Haus lebten, solange sie etwas für die Familie arbeiteten, ist heute der isolierte Fresser getreten, was bei wenig wundert, wenn man weiß, dass in Stuttgart mehr als jeder zweite Haushalt ein Einoersonen-Haushalt ist. Das können Alte sein, deren Partner gestorben ist, aber auch Junge, die keinen Partner haben, egal warum.
Dadurch ist für viele Menschen das gemeinsame Essen etwas Fremdes geworden. Jüngere haben häufig schon nicht mehr morgens mit den Eltern gefrühstückt, weil sie eilig in die Schule mussten und statt Vesper ein gekauftes Süßes Stückchen, oder etwas Geld bekamen. Mittags sind die Eltern bei der Arbeit und die Kinder können von Glück sagen, wenn in der Schule ein gutes Mittagessen angeboten wird. Sie erleben also auch nur noch selten zuhause, wie Lebensmittel zubereitet werden. Höchstens, wenn sie Kochsendungen anschauen, was für Kinder vermutlich weniger reizvoll ist.
Der Wandel der Arbeitsbedingungen von der handwerklichen Herstellung hin zur Industriellen Produktion (ob die Fremdworte etwas höher Wertiges nahelegen sollen?) hat die Art und Weise der Erzeugung von Lebensmitteln und Gütern sich von einer Tätigkeit, die man gemeinsam ausführte (Ernte auf dem Felde oder im Weinberg, Zusammenarbeit in der Werkstatt) zu etwas gewandelt, bei dem der Einzelne nur noch bestimmte Tätigkeiten leistet, ohne, dass er das Ganze jemals zu Gesicht bekäme. Im Extremfall füttert man eine Maschine mit Kommandos und die macht dann irgend etwas, wofür man Geld bekommt. Karl Marx nannte diesen Vorgang „Entfremdung”, aber das wäre ja eigentlich, wenn man Fremde kennen lernt und zu Bekannten oder Freunden wird. Gemeint ist eigentlich, dass etwas Vertrautes, etwas was man sinnlich erleben kann zu etwas wird, das einem fremd ist. Was Marx richtig erkannte war, dass die Art und Weise, wie man arbeitet, auch Wirkungen auf das eigene Leben hat. Es hat mit dem Wandel der Arbeitsbedingungen ein Wandel der Familienstrukturen und des Zusammenlebens statt gefunden, den man genauer betrachten müsste, um ihn zu verstehen und zu bewerten.
In den fünfziger Jahren vor der Fresswelle verstand man noch recht sparsam zu wirtschaften. Meine Großmutter ging mit mir Beeren, Hagebutten und Obst sammeln, das dann zu Marmelade, Kompott, oder Rumtopf verarbeitet wurde. Ein Vergammeln von Lebensmitteln, wie heute, gab es damals in den kargen Zeiten nach dem Krieg nicht. Damals war die Küche das „Reich der Hausfrau”. Meine Mutter hatte in der Küche eine Karikatur aufgehängt, auf der ein Mann abends nach hause kommt, die Frau sich ihm zum Willkommenskuss zuwendet, er aber den Kochtopfdeckel hebt und voller Vorfreude hinein schaut, statt sie zu küssen. Ich bin nicht sicher, ob darunter stand: „Liebe geht durch den Magen”. Aber das „liebevoll” zubereitete Essen am schön gedeckten Tisch, das erwartete man von der „guten” Hausfrau. Meine Mutter hatte erst in Deutschland lernen müssen zu kochen, da in China dafür Dienstboten zuständig waren, oder man zum Essen aus ging. Dafür hatte sie gearbeitet. Auch, als sie verheiratet war und den Mann nach deutschem Recht um Erlaubnis fragen musste, ob sie arbeiten dürfe, hatte sie gearbeitet, aber auch den Haushalt erledigt und später meinen Vater gepflegt. Die viel beschworene Emanzipation der Frau, war vor allem das Aufbürden zusätzlicher Lasten, statt einer neuen Balance der Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau.
Was ging da verloren?
Im Kern die Fähigkeit Lebensmittel zu erkennen, auszuwählen und zuzubereiten. Die Tischkultur, das den Tisch schön decken, war eher eine Erfindung des Bürgertums, um sich von anderen Bevölkerungsgruppen abzuheben. Noch im Mittelalter waren die Werkzeuge zum Essen so rar und kostbar, dass jemand, der starb, seinen Löffel an einen Erben weiter gab (daher: „den Löffel abgeben”). Man aß das Mus häufig aus einer gemeinsamen Schüssel. Teller, wenn man welche hatte, wurden auf einem Wandbord als sichtbarer Wohlstand ausgestellt.
In frühen Zeiten waren Mus aus Körnern oder Mehl, die gerade verfügbaren Früchte, Pilze, getrocknetes Obst und Nüsse wichtige Lebensmittel. Fleisch gab es, wenn überhaupt an Feiertagen, daher der „Festtagsbraten”.
Erst mit der Entdeckung Amerikas kamen viele neue Lebensmittel nach Europa (Bohnen, Tomaten, Mais, Kartoffeln, Paprika, usw.) An den Straßenecken entstanden noch später „Kolonialwarenläden”, in denen man die damals als exotisch geltenden Lebensmittel aus Übersee kaufen konnte. Mit jedem neuen Lebensmittel musste man auch dessen Zubereitung erlernen. Die Vielfalt der Lebensmittel nahm stark zu, wenn man sich darauf einließ und sie bezahlen konnte.
Dabei konnte man auch viele Gemüse in der Gärtnerei in der Nachbarschaft so frisch erwerben, wie es heute nicht mehr möglich ist. Wenn wir beim Abendspaziergang einen Rettich kauften, dann landete der etwa eine Viertelstunde nachdem er vor unseren Augen aus dem Boden gezogen worden war, auf dem Esstisch.
Dass das Erlebnis solcher Frische verloren ging, hat aber nicht nur mit dem Verschwinden der Gärtnereien im Viertel zu tun, sondern auch mit der Verdrängung des Ladens an der Ecke durch große Supermärkte auf der Grünen Wiese, oder im Keller eines Kaufhauses. Das sagt ja auch etwas über die Wertschätzung der Nahrung aus.
Ein weiterer Grund sind neue Züchtungen, die häufig vor allem darauf aus waren, die Früchte länger lagerfähig zu machen, oder deren Haut so zu stärken, dass eine Maschine sie ernten kann. Nährwert, Geschmack oder Bekömmlichkeit blieben eher auf der Strecke. Ja bei Äpfeln wuchs bei neuen Sorten deren Fähigkeit Allergien auszulösen. Aber der Kunde kennt und bekommt die alten Sorten nicht mehr.
Das heißt: Nicht nur das Wissen um die Lebensmittel-Erzeugung, Behandlung und Zubereitung ging verloren, sondern auch die Frische und die Auswahl. Von den 2300 Apfelsorten, die 1880 in Preussen angebaut wurden, sind noch 1500 übrig, von denen man aber nur noch 30-40 im Gartengroßmarkt als Pflanzen kaufen kann und von denen man nur noch eine Handvoll im Laden bekommt.
Neuester Streich der 5 großen Lebensmittelvermarkter ist, das man den Namen der Kartoffelsorten nicht mehr ans Regal schreibt. Wenn der Kunde Glück hat, steht er auf der Packung. Wenn nicht, muss er die Katze im Sack kaufen. Nur ob sie mehlig oder festkochend sind, erfährt er noch vom Regalschild. „Kunde friss, oder stirb!”, soll das wohl signalisieren. Die Branche, angefangen von den Bauern bis hin zum Handel, hat offenbar immer nicht nicht begriffen, dass der ganze Bereich der Biolebensmittel eine einzige Misstrauenserklärung für die herkömmliche Landwirtschaft und deren Vermarkter ist. Nicht nur, dass die Bauern mehr Dünger und Spritzmittel anwenden, als für die Natur und uns alle gut ist, nein die Vermarkter behaupten zwar, sie liebten Lebensmittel, aber sie transportieren alles, vom Toast bis zur Tomate, im Kühllaster und nehmen in Kauf, dass der Toast schimmelt und die Tomate nicht mehr so lange lagerfähig und lecker ist, wie eine, die man zum richtigen Zeitpunkt vom Stock erntete.
Soweit, die handwerkliche Seite der Auswahl und Zubereitung von Lebensmitteln. Dass Krankheiten durch falsche Ernährung (Allergien, Mangelernährung, Übergewicht) zugenommen haben, wundert wenig. Das aber verrät, dass die Fähigkeit für sich selbst zu sorgen verloren ging. Man weiß gar nicht mehr, was einem gut tut, was einem bekommt, was einem im Magen liegt, oder wovon man besser nicht zu viel zu sich nimmt. Kein Wunder, wenn Einpersonenhaushalte ein Lager von Konserven und anderen länger lagerbaren Lebensmitteln anschaffen, aber nur einen Teil davon benutzen und den Rest nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums weg werfen, weil sie gar nicht mehr beurteilen können, ob das Lebensmittel noch gut ist, oder nicht. Frisch wird kaum noch etwas zubereitet, schon allein, weil solche kleinen Mengen im Laden besonders teuer und in der Zubereitung mühsam sind.
Der Handel reagiert darauf mit immer mehr Angeboten, die für eine Zwischenmahlzeit im Gehen geeignet sind, oder aber Portionsweise gekauft und zubereitet werden können. Was einst mit Brühwürfeln und Tütensuppen begann, ist heute das fertige panierte Schnitzel beim Metzger, oder der Salat, samt Soße im Kühlregal. Auch in der Gastronomie werden schon länger halbfertige oder fertige Produkte benutzt, um die Gäste schneller bedienen zu können.
Was kann man dagegen tun?
Man muss wieder lernen für sich selbst zu sorgen. Das könnte vielleicht auch das Interesse an Kochbüchern und Kochsendungen erklären, weil die Leute merken, dass ihnen etwas fehlt, dass sie nicht wissen, wie es richtig geht.
Da man sich auf Landwirtschaft und Handel nicht verlassen kann, muss man also selbst aktiv werden. Das bedeutet, dass man wieder lernen muss gut zu sich selbst zu sein. Das heißt, das man lieber weniger, aber dafür bessere Lebensmittel kauft, dass man übt sie lecker zuzubereiten und auch darauf achtet, wie sie einem bekommen. Am Besten fängt man mit ganz einfachen Gerichten an und steigert sich im Laufe der Zeit, so weit, wie man Lust hat.
Wenn man sich dann noch den Tisch hübsch deckt, hat man noch ein wenig mehr für sich selbst getan. Und wer zum Essen Bekannte und Freunde einlädt, der hat wenigstens ab und zu auch wieder Gesellschaft, die dem Menschen ja auch gut tut.
Wer kann, könnte sich ein paar Sachen im Garten anbauen, oder aber beim nächsten Bioladen oder noch besser Biohof einkaufen, wo man dann auch lernen kann, wie die Lebensmittel angebaut werden und was das für die Umwelt bedeutet. Das Bioware nicht nur der Umwelt gut tut, zeigte eine Analyse der Bakterien, die auf ihnen siedeln: Auf Bioware sind mehr für den Menschen nützliche, als auf herkömmlichen Produkten. Man tut also auch seinem Körper etwas Gutes, wenn man Bioware bevorzugt.
Möglicherweise stellt sich im Laufe der Zeit nicht nur das verloren gegangene Wissen wieder ein, sondern auch ein Zuwachs an Genuss, weil der Geschmack sich ebenfalls weiter gebildet hat.
Das Bild oben zeigt, dass eine Soße aus Hackfleisch und Gemüse zusammen mit Brokkoli und Spaghetti sogar für‘s Auge etwas bietet.