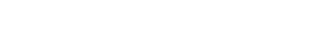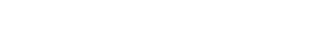Stadtmuseum

Carl-Josef Kutzbach
Samstag, 25. Januar 2020
Unverständlich
Wer in das Wilhelmspalais (Palais ist sprachlich verwandt mit Palast) in Stuttgart will, benutzt dazu, vom Charlottenplatz kommend, eine geschwungene Rampe. Das war schon zur Zeit seiner Erbauung für Wilhelm den I. (von Salucci 1834-40) so, das war nach der Umgestaltung zur Stadtbücherei und Stadtarchiv (1965) so und ist heute nach dem aufwändigen Umbau (bis 2018) zum Stadtmuseum wieder so. Es sei denn man kommt vom Hang herab durch den Garten von der Urbanstraße oder Uhlandstraße her (siehe Foto unten).

Der Wohnsitz von Wilhelm dem Zweiten, den er 1918 verließ, als Pöbel das Haus stürmte und seine Abdankung verlangte, während er längst den Wandel mit gestaltete und just am Tage des Eindringens in sein Wohnhaus, eine neue Regierung vereidigt hatte, war im 2. Weltkrieg ausgebombt worden. Für die Stadtbücherei, mit ihren vielen schweren Büchern, hat man 1961-65 innerhalb der alten Gebäudehülle einen stabilen Neubau errichtet, der vermutlich die Last, die das Stadtmuseum mit seinen Besuchern darstellt, gut verkraftet hätte. Es hätte wohl genügt, die Leitungen zu sanieren und eine zweite Treppe als Fluchtweg bei Bränden einzubauen.
Beim Schild an der Fassade war man sparsamer, da man das „Stadt” von der Stadtbücherei hängen ließ und mit einem „Palais” ergänzte, die beide nachts von hintern beleuchtet werden. Dass ein „Palais”, ein herrschaftlicher Palast nicht gut zu demokratischen Zeiten passt, wurde übersehen. Dafür hat man die Statue des Königs mit seinen beiden Hunden von vor dem Haus seitlich in den Garten verpflanzt, wo er darüber nachzusinnen scheint, womit er denn dass verdient habe. Didaktische Möglichkeiten zum Übergang vom Königreich zur Demokratie, also auch vom Wandel politischer Systeme, werden leider nicht genutzt.

Die Raumaufteilung des U-förmigen Gebäudes ist im Wesentlichen gleich geblieben, nur wurde der Treppenturm im Eingangsbereich entfernt und durch zwei breite Treppen rechts und links ersetzt, an denen sich bereits eine Fragwürdigkeit der Gestaltung ablesen lässt. Die mit hellem Holz verkleideten Wände, und damit auch die zwischen den Treppen sind so breit und massiv, dass man daran ein Geländer, einen Handlauf anbringen musste. So freundlich das helle Holz ist, so prägend ist es auch, was für Museumsräume fragwürdig ist. Dort sollte das im Mittelpunkt stehen, was gezeigt werden soll, nicht die Wände.
Der zwei Geschosse hohe Raum auf der Mittelachse des U-förmigen Gebäudes, in dem früher eine Empore für die Zeitungsleser war, enthält jetzt im Zwischengeschoss die Garderobe, die früher links neben dem Eingang war. Allerdings kann man einen langen Mantel nicht aufhängen, sondern muss ihn zusammenlegen und in ein Schließfach tun, wenn man keinen Diebstahl riskieren will.
Geschichten, statt Geschichte
Statt der Stadt-Geschichte findet man im Stockwerk darüber „Stadtgeschichten”. Genau so beliebig wirkt die Ausstellung. Zwischen den beiden Treppenhäusern ist eine Art Tisch mit schwarzem Rahmen darüber, auf dessen Innenseite weiße Schrift verkündet, dass es hier um Personen der Stadt gehe. Die werden dann durch Fußballtrikot, Pokale oder ein Modell eines Denkmals repräsentiert. Warum Personen am Anfang einer stadtgeschichtlichen Sammlung stehen, erschließt sich dem Betrachter nicht. Natürlich gäbe es die Stadt und ihre Geschichte nicht ohne Personen, aber warum gerade diese und nicht etwa der Fürst, der die Stadt gründete, oder die Residenz nach Stuttgart verlegte und damit Arbeitsplätze und Handel förderte? Wie in der gesamten Ausstellung fehlt eine dem Laien einleuchtende Begründung, warum man gerade dies zu sehen bekommt. Vielleicht soll der Sport den Laien für das Museum einnehmen? Man erkennt es nicht.
Der große hohe Raum über der Halle im Erdgeschoss wird von einem Stadtrelief dominiert, das wiederum von dicken schwarzen Rändern umgeben ist, auf das viele Informationen projiziert werden. Manches ist auch nur läppisch, etwa, wenn Wolken und Blitze mit Donner unterlegt werden. Wer sich mit der Lage der Stadt vertraut machen will, wird ständig durch die eingeblendeten Grafiken abgelenkt. Das Schwarz der Umrandung des Stadtgebietes und der Vitrinen bildet einen unangenehm harten Kontrast zu dem hellen Holz der Wandvertäfelung und macht die Räume dunkler als nötig. Auch die dunklen Fensterrahmen machen die Räume dunkler.
Medien statt Originale
Es ist vielen Museumsmachern nicht klar, dass statische Medien, wie Bild und Text jedem Besucher die Freiheit lassen sich so lange damit zu befassen, wie es für diese Person nötig ist, um alles Wesentliche und Wissenswerte zu erkennen, oder bei Desinteresse weiter zu gehen. Die heute weit verbreiteten und beliebten audiovisuelle Medien, für die man immer Geräte benötigt (die nach einigen Jahren versagen), bieten zwar Bewegung (optische Reize), aber sie zwingen den Besucher das Gebotene in dem Tempo aufzunehmen, wie es der Macher für richtig hielt. Zudem tritt man oft mitten in einer Bilder- oder Ton-Folge heran und muss dann warten, bis das, was einen vielleicht interessiert, eventuell noch kommt.
Zeitkritische Medien (audiovisuelle) langweilen jene, die schnell das Wesentliche begreifen und überfordern diejenigen, die langsamer sind. Nur die paar sind zufrieden, die in dem Tempo wahrnehmen, wie es sich die Macher ausdachten. Abgesehen davon sind heute Bildschirme und Tonquellen so weit verbreitet, dass fast jeder sie mit sich herum trägt. Das bedeutet, um diese Darstellungen zu sehen, müsste man eigentlich nicht ins Museum, sondern könnte sie auch online anschauen, wenn sie dort angeboten würden. Was das Museum einzigartig machen kann, sind also nicht Medien, sondern Originale, die es sonst nirgend wo zu sehen gibt.
Beim Modell im zentralen Raum der Ausstellung dauert das Programm etwa 15 Minuten. Allerdings kann man an entsprechenden Pulten bestimmte Informationen auch selbst aufrufen, was dann den, der geduldig dem Programm folgte, aus dem Konzept und um die Früchte seines Wartens bringt. Es wäre spannend zu beobachten, ob Schulklassen sich auf die verschiedenen Pulte verteilen und dann in einen Wettstreit eintreten, wer was als Erster vorgeführt bekommt.
Ein digital aufgerüstetes Geländemodell der Stadt – in dem sich die Meisten erst einmal zurecht finden müssen - als Kern der Ausstellung über Stadtgeschichte ist nicht sehr anschaulich, geschweige denn sinnlich, und vermitteln zwar eine Menge Informationen, die man aber noch gar nicht braucht, weil man ja die Geschichte der Stadt noch nicht kennt. Also fragt man eine Aufsicht, wo man denn mit der Besichtigung anfangen solle. Die verweist auf den östlichen Flügel, wo es allerdings im 18. Jahrhundert los geht, als ob Stuttgart da nicht schon mindestens 600 Jahre existiert hätte.
Auf dem Weg dorthin spricht einen eine schwarze Vitrine zur „Sprache” an und in einer zum Thema „Zoo” steht ein Vogel Strauß. Was der für die Stadtgeschichte bedeuten soll, könnte man vielleicht am Text erfahren, der allerdings von Älteren erfordert die Lesebrille aufzusetzen.
Reduzierte Stadtgeschichte
An den Wänden im Ostflügel ein paar Bildschirme, auf denen sich Bilder über einander schieben, also wieder den Betrachter zwingen „schnell zu schauen”. In der Mitte eine Landschaft aus Tischen und Gegenständen, die keinerlei Systematik zu folgen scheint. Ein frühes Fahrrad („Bitte nicht berühren!”) steht neben einem Klavier (Stuttgart hatte mehrere Klavierbauer). Auf den schwarzen Tischen manchmal Karten, deren Inhalte in weiß, gelb und glänzendem Schwarz dargestellt sind, das man auf dem matt schwarzen Grund schlecht sieht. Drahtmodelle von Gesichtern und anderem sind hie und da eingestreut. Was sie sollen, erschließt sich dem flüchtigen Betrachter nicht.
Dass Stuttgarts erstem Bahnhof Raum eingeräumt wird, ist angesichts des Streits um die Umgestaltung des zweiten Bahnhofs zur U-Bahnstation verständlich, aber nicht zwingend. Reizvoller wäre zu erfahren, dass trotz des neuen Verkehrsmittels Bahn noch viele Jahre Hunderte von Feuerbach über den Feuerbacher Weg zu Fuß nach Stuttgart zur Arbeit gingen, weil ihnen die Fahrkarte zu teuer war.
Im Westflügel geht es dann im selben Stil weiter, wobei etwa ein Schild von 1938, auf dem gefordert wird nur noch Erbsen anzubauen, die vom Reich zugelassen sind, eine gute Gelegenheit böte, um die heutige Rechtslage (Patentierbarkeit von Pflanzen) zu problematisieren, die dem Bauern das erneute Anbauen von aus Saatgut gewonnen Samen verbietet, wenn er dafür nicht an den Saatguthersteller bezahlt (der so - ohne Arbeit - Geld kassiert). Auch das Modell des Kaufhauses Schocken wäre eine Möglichkeit um auf den Stuttgarter Städtebau und die Abrisse von Denkmälern zu reden, wie das beim Kronprinzenpalais anklingt.
In der Westhälfte des großen Raumes stehen weitere schwarze Vitrinen, etwa mit der RAF, die vielleicht nicht so viel Raum gebraucht hätte, oder auch ein Fahrkartenautomat. Dabei ist die Leuchtschrift, die eine Überschrift darstellt, oft so weit oben, dass man den Kopf in den Nacken legen müsste, um sie zu lesen.
Ist der Besucher willkommen?
Es ist den Ausstellungsmachern offenbar nicht klar, wie man einen Gast empfängt und wie man dem ein Haus, eine Ausstellung zeigt. Zunächst grüßt man freundlich (hier empfängt eine große freie Fläche auf die von oben Straßenlampen herab hängen), dann hilft man ihm beim Ablegen, damit er sich wohl fühlt (hier muss man die Garderobe erst einmal suchen). Dann führt man ihn nach einem bestimmten Konzept durch das Haus, oft so, dass am Ende des Rundgangs der Höhepunkt (z.B. das Schwimmbad, der Garten, die Terrasse) steht. So ein Rundgang folgt einer Dramaturgie, die etwas über den Gastgeber aussagt. Die ist hier nicht erkennbar.
Das Ganze erinnert fatal an jene Dorfmuseen, in denen man alles Alte sammelte und eben so darstellte, wie es der Platz erlaubte. Es mag ja sein, dass die Macher ein Konzept hatten, auch wenn die Ausstellung mehr an eine Stoffsammlung für einen Aufsatz erinnert, aber was nützt das, wenn es dem Besucher nicht klar wird? Das könnte allerdings auch daran liegen, dass man – laut Beschriftung – gar nicht die Stadtgeschichte darstellen wollte, sondern „Stadtgeschichten” erzählen. Die Geschichte ist ein sehr langer Vorgang, den man verschieden deuten kann. Geschichten dagegen müssen nicht mal wahr sein und greifen nur einzelne Themen auf, ohne sie, wie die Geschichte, in einen Zusammenhang zu stellen. Dafür hätte man keinen aufwändigen Umbau gebraucht, aber auch kein Stadtmuseum.

Die Aufnahmen des Wilhelmspalais zeigen oben den fragwürdigen Schriftzug an der Fassade, die dank heller Fensterrahmen freundlicher wirkende Stadtbücherei, die Statue des beliebten Wilhelm II. im Abseits des Gartens, sowie die Gartenseite, der die dunklen Fensterrahmen etwas Ernstes verleihen.